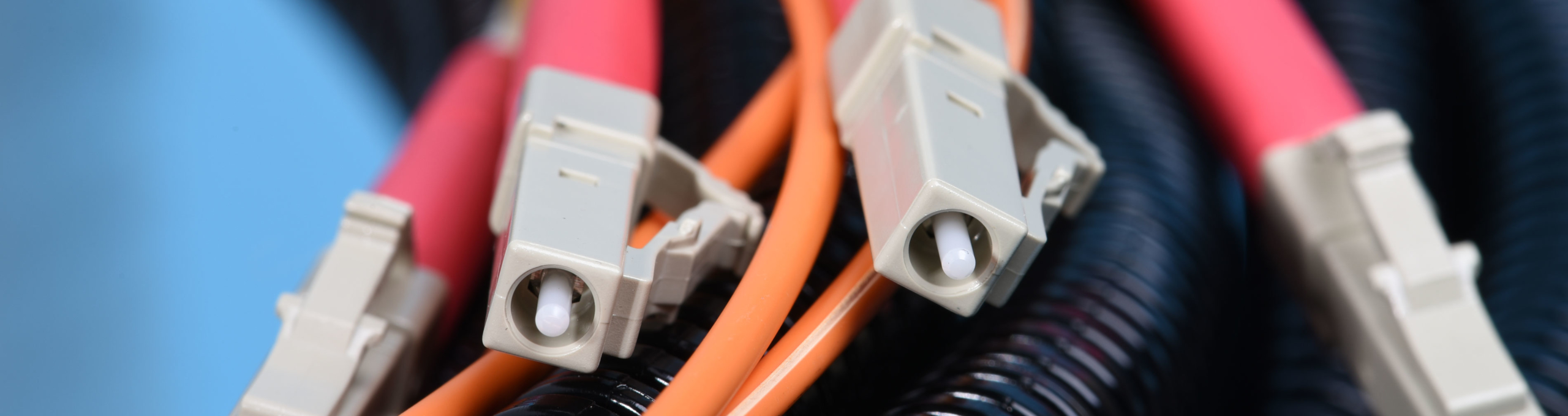Mit USV überbrückbare Zeit: 24h, 48h, 72h, 120h – was Sie wissen sollten
25.03.2025 / Paul Zweigert
In unserer digitalisierten Welt ist eine zuverlässige Stromversorgung unerlässlich. Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) spielen eine entscheidende Rolle, um kritische Systeme bei Stromausfällen zu schützen. Doch wie lange sollte eine USV überbrücken können? In diesem Blog erläutere ich die verschiedenen Überbrückungszeiten von 24, 48, 72 und 120 Stunden und erkläre, welche Faktoren bei der Auswahl der richtigen USV-Lösung entscheidend sind.
Warum ist eine USV mit langer Überbrückungszeit sinnvoll?
Eine USV mit langer Überbrückungszeit ist sinnvoll, weil ein kurzfristiger Stromausfall schon viel Schaden anrichten kann. Was aber, wenn der Ausfall mehrere Stunden oder gar Tage anhält? Das kann passieren, wenn es Naturkatastrophen, Netzüberlastungen oder Cyberangriffe gibt. Eine USV mit langer Überbrückungszeit kann in diesen Fällen den Unterschied zwischen reibungslosem Betrieb und totalem Stillstand ausmachen. Kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Wasserwerke oder Telekommunikationsanbieter sind auf eine kontinuierliche Stromversorgung angewiesen. Ein Stromausfall kann hier lebensbedrohliche Folgen haben oder wichtige Dienstleistungen unterbrechen.
In Rechenzentren gehen bei einem Stromausfall wichtige Daten verloren, oder das System fällt aus – beides kann viel Geld kosten. USV-Systeme sorgen dafür, dass Server und andere wichtige IT-Infrastrukturen auch bei Stromausfällen weiterlaufen, bis der Strom wieder zurückkehrt. In der Industrie verhindern USV-Systeme Produktionsausfälle, indem sie Maschinen am Laufen halten, auch wenn der Strom ausfällt.
Überbrückungszeiten im Vergleich
Die Größe und Kapazität einer USV hängt davon ab, wie lange sie im Fall eines Stromausfalls Energie liefern soll.
- Eine USV für 24 Stunden ist ideal für Haushalte und kleine Unternehmen, die nur kurzzeitig Strom brauchen. Diese Systeme sind kompakt, günstig und müssen regelmäßig gewartet werden.
- Für längere Stromausfälle sind 48-Stunden-USV-Systeme besser, auch wenn sie teurer und größer sind.
- In Regionen mit instabilem Netz oder sensiblen Bereichen reicht eine 72-Stunden-USV, die allerdings teurer und schwieriger zu warten ist.
- 120-Stunden-USV-Systeme stellen die ultimative Notfalllösung dar. Sie kommen dort zum Einsatz, wo eine sofortige Wiederherstellung der Stromversorgung nicht gewährleistet werden kann. Sie sind extrem teuer und benötigen viel Platz.
Die Wahl der richtigen USV hängt von der Größe des Betriebs, den spezifischen Anforderungen und Risiken ab. Ein kleiner Betrieb könnte eine 72-Stunden-USV brauchen, wenn er auf Datenverarbeitung angewiesen ist, sicherheitsrelevante Anwendungen hat oder in einer Region mit häufigen Stromausfällen liegt. Auch Kundenwünsche können eine längere Überbrückungszeit rechtfertigen.
Welche Technologie eignet sich für Langzeit-USVs?
Es gibt verschiedene Technologien für Langzeit-USVs, jede mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen, je nach Anforderungen, Kosten und Wartungsaufwand. Zu den gängigsten Technologien gehören:
- Lithium-Ionen-Akkus
- Blei-Säure-Batterien
- Brennstoffzellen
- Hybridlösungen mit erneuerbaren Energien
Lithium-Ionen-Akkus zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte, eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsaufwand aus. Aufgrund ihrer Effizienz und Zuverlässigkeit kommen sie besonders in professionellen und industriellen Anwendungen zum Einsatz. Allerdings sind die Anschaffungskosten vergleichsweise hoch, sodass sie sich vor allem für Systeme eignen, bei denen Platz und Gewicht eine entscheidende Rolle spielen.
Blei-Säure-Batterien sind günstiger in der Anschaffung und werden seit Jahrzehnten in USV-Systemen eingesetzt. Sie haben jedoch eine geringere Energiedichte als Lithium-Ionen-Akkus und sind wartungsintensiver. Zudem sind Blei-Säure-Batterien relativ schwer und nehmen viel Platz ein, weshalb sie insbesondere in stationären Anwendungen genutzt werden.
Für besonders lange Laufzeiten bieten Brennstoffzellensysteme eine attraktive Alternative zu herkömmlichen Batteriespeichern. Sie erzeugen Strom aus Wasserstoff oder Methanol und können bei kontinuierlicher Brennstoffzufuhr über Wochen oder sogar Monate eine zuverlässige Notstromversorgung gewährleisten. Der Nachteil liegt in den höheren Investitionskosten sowie der Notwendigkeit, regelmäßig Brennstoff nachzuliefern.
Hybridlösungen mit erneuerbaren Energien sind eine Kombination aus Batterien, Solarpanels und gegebenenfalls Windgeneratoren und können eine besonders nachhaltige Lösung für Langzeit-USVs darstellen. Solche Systeme reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und ermöglichen eine nahezu autarke Stromversorgung. Allerdings hängt die Verfügbarkeit der erneuerbaren Energien von den Umweltbedingungen ab, weshalb in vielen Fällen ein zusätzliches Speichersystem erforderlich ist.
Welche Technologie am besten geeignet ist, hängt von Faktoren wie Autonomie, Standort, Betriebskosten und Anpassungsfähigkeit ab. In Rechenzentren werden oft Lithium-Ionen- oder Blei-Säure-Batterien benutzt, während Brennstoffzellen für Anwendungen ideal sind, die sehr lange laufen sollen. Hybridlösungen mit erneuerbaren Energien sind nachhaltig und in abgelegenen Gebieten eine gute Alternative. In kritischen Anwendungen kann eine Kombination mehrerer Systeme sinnvoll sein.
Kosten-Nutzen-Abwägung bei der Wahl der Überbrückungszeit
- Anschaffungskosten: Die Kosten für leistungsfähigere USV-Anlagen und größere Batteriespeicher steigen mit zunehmender Überbrückungszeit deutlich an.
- Platzbedarf: Längere Überbrückungszeiten erfordern größere Energiespeicher, was sich auf den verfügbaren Platz und die Standortplanung auswirkt.
- Wartung und Austauschzyklen: Batterien und Komponenten unterliegen einem natürlichen Verschleiß und müssen regelmäßig gewartet oder ausgetauscht werden, was die Betriebskosten erhöht.
- Effizienz und Energieverluste: Je länger eine USV aktiv bleiben soll, desto wichtiger ist es, den Energieverbrauch zu optimieren und Verluste zu minimieren.
Viele Unternehmen setzen auf eine Hybridlösung, die USV-Systeme mit Netzersatzanlagen wie Dieselgeneratoren oder erneuerbaren Energien kombiniert. So lässt sich eine zuverlässige und wirtschaftlich sinnvolle Absicherung gegen Stromausfälle erreichen.
Fazit: Welche USV-Überbrückungszeit ist die richtige?
Welche USV Sie brauchen, hängt davon ab, was Sie damit machen wollen. Eine USV für 24 Stunden reicht für viele Unternehmen aus, während für kritische Infrastrukturen eine USV mit einer Überbrückungszeit von 48 Stunden oder länger nötig ist. In hochsensiblen Bereichen braucht man manchmal eine USV, die 72 oder sogar 120 Stunden überbrückt. Dabei sollten neben den Kosten auch Platzbedarf, Wartungsaufwand und alternative Energiequellen berücksichtigt werden.